Ich schreibe meistens über Dinge, die mich begeistern oder eben nicht. Mehr zu uns findest du auf der Agentur-Seite.
Was ist Barrierefreiheit?

Manchmal fühlt sich eine Website an wie ein guter Gastgeber: freundlich, übersichtlich, unkompliziert. Alles ist da, wo du es brauchst – ohne dass du gross nachdenken musst. Aber was, wenn du nicht sehen kannst, was andere sehen? Wenn du keine Maus bedienen kannst oder Texte schwer erfassbar sind? Plötzlich wird aus Leichtigkeit Barriere. Accessibility bedeutet, digitale Räume so zu gestalten, dass alle sich willkommen fühlen – ganz gleich, welche individuellen Bedürfnisse sie haben.
- Warum ist Barrierefreiheit wichtig?
- Grundprinzipien der digitalen Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit in der Praxis
- Schriften für Dyslexie und einfache Sprache
- Unterstützung durch Icons
- Webinhalte für neurodivergente Menschen
- Inklusion durch Empathie
- Tastatur-Navigation und Tab-Reihenfolge
- Rechtliche Grundlagen und Standards in der Schweiz und EU
- Testing und Qualitätssicherung
- Trends und Zukunft der digitalen Barrierefreiheit
Warum ist Barrierefreiheit/Accessibility wichtig?
Barrierefreiheit im digitalen Raum sorgt dafür, dass niemand ausgeschlossen wird. Millionen von Menschen sind auf eine zugängliche Gestaltung angewiesen, sei es durch barrierefreie Textgestaltung, klare Strukturen oder eine benutzerfreundliche Navigation. Sie stellt sicher, dass alle die gleichen Chancen haben, digitale Inhalte zu nutzen.
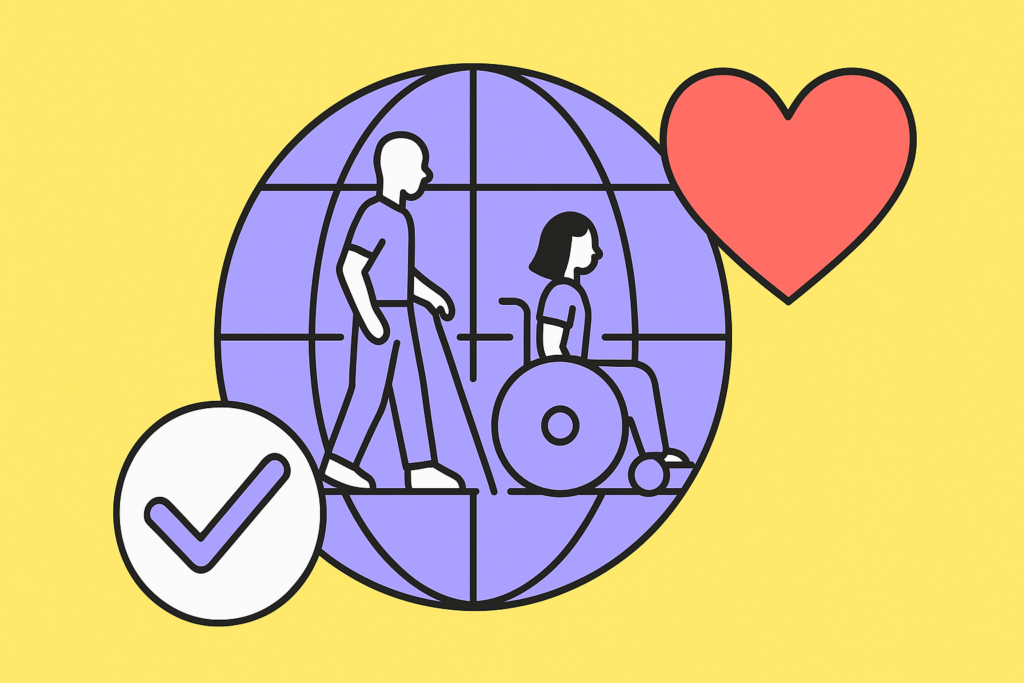
Grundprinzipien der digitalen Barrierefreiheit
Damit digitale Inhalte für alle zugänglich sind, gibt es vier zentrale Prinzipien:
- Wahrnehmbar: Inhalte müssen so dargestellt werden, dass alle Nutzenden sie erfassen können – etwa durch ausreichend Kontraste, Alternativtexte für Bilder oder Untertitel für Videos.
- Bedienbar: Webseiten und Apps müssen ohne Hindernisse navigierbar sein. Dazu gehören eine logische Struktur, Tastaturbedienbarkeit und ausreichende Zeit zum Lesen und Interagieren.
- Verständlich: Informationen und Navigationselemente müssen klar formuliert sein. Klare Sprache, vorhersehbare Abläufe und gut strukturierte Inhalte sind essenziell.
- Robust: Digitale Angebote müssen mit unterschiedlichen Technologien kompatibel sein, sodass sie beispielsweise von Screenreadern oder Spracherkennungssoftware genutzt werden können.
Barrierefreiheit in der Praxis
Eine barrierefreie Website beginnt mit kleinen, aber wirkungsvollen Anpassungen:
- Alternativtexte für Bilder, damit Screenreader sie beschreiben können
- Untertitel und Transkriptionen für Videos
- Klare und verständliche Sprache
- Genügend Kontrast zwischen Text und Hintergrund
- Fokus auf eine einfache Navigation mit Tastatur und Screenreader
- Ausreichend hohe Schriftgrösse und ein leicht erhöhter Zeilenabstand
- Flexible Schriftgrössen, die individuell angepasst werden können
- Ein etwas fetterer Schriftschnitt und hoher Kontrast sorgen für gute Lesbarkeit, ohne dass Anpassungen nötig sind
Schriften für Dyslexie und einfache Sprache
Bestimmte Schriftarten wie OpenDyslexic oder speziell gestaltete serifenlose Schriften erleichtern Menschen mit Dyslexie das Lesen. Klare Buchstabenformen und ein ausgewogener Zeichenabstand verhindern das Verschmelzen von Buchstaben. Ergänzend hilft eine einfache Sprache mit kurzen, klaren Sätzen und einer logischen Struktur.
Unterstützung durch Icons
Die Verständlichkeit von Texten kann durch Icons erhöht werden, indem sie wichtige Inhalte visuell unterstreichen. Dies hilft insbesondere Menschen mit Lernschwierigkeiten oder geringer Lesekompetenz. Doch Vorsicht: Die Symbole sollten intuitiv verständlich sein und immer mit erklärendem Text kombiniert werden.
Webinhalte für neurodivergente Menschen
Eine klare, vorhersehbare Informationsstruktur ist für viele Menschen wichtig – besonders wenn sie neurodivergent sind oder kognitive Besonderheiten haben. Dazu gehören unter anderem Menschen mit Asperger-Syndrom, Hochsensibilität oder Downsyndrom.
Reizüberflutung durch grelle Farben, unerwartete Animationen oder zu viele Informationen auf einmal kann belastend sein. Hier helfen reduzierte Designs, gut gegliederte Inhalte, die Möglichkeit, Ablenkungen auszublenden, sowie Optionen wie Dark Mode, die visuelle Reize minimieren.
Inklusion durch Empathie
Barrierefreiheit bedeutet nicht nur die Anpassung an physische oder kognitive Einschränkungen, sondern auch eine bewusste Gestaltung digitaler Räume für gefährdete Gruppen. So können Filtermechanismen helfen, sensible Inhalte für suizidgefährdete Menschen auszublenden. Ebenso kann eine warme, wertschätzende Sprache in Kontaktformularen oder Hilfsangeboten emotionale Unterstützung bieten.
Tastatur-Navigation und Tab-Reihenfolge
Viele Nutzende sind auf die Bedienung von Webseiten per Tastatur angewiesen, insbesondere durch die Tabulator-Taste (Tab). Dabei wird durch interaktive Elemente wie Links, Schaltflächen oder Formulare navigiert. Damit dies effizient funktioniert, muss die Tab-Reihenfolge logisch sein. Elemente sollten in einer sinnvollen Reihenfolge angesteuert werden, um eine intuitive Navigation zu ermöglichen. Zudem sollten aktive Elemente mit einer deutlich sichtbaren Fokusmarkierung versehen sein, sodass Nutzende stets erkennen, wo sie sich befinden.
Best Practices für die Tab-Navigation
- Die Reihenfolge der interaktiven Elemente sollte der logischen Lesereihenfolge entsprechen.
- Wichtigste Inhalte zuerst erreichbar machen, unnötige Tab-Stops vermeiden.
- Fokuszustände visuell hervorheben (z. B. mit einer deutlichen Umrandung).
- Nutzerfreundliche Sprungmarken einbauen, um lange Inhalte zu überspringen.
- Formulare und interaktive Elemente so gestalten, dass sie mit der Tastatur vollständig bedienbar sind.
Rechtliche Grundlagen und Standards in der Schweiz und EU
In der Schweiz ist die digitale Barrierefreiheit durch verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen geregelt. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) verpflichtet Bund, Kantone und Gemeinden dazu, ihre digitalen Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten. Private Anbieter von öffentlich zugänglichen Dienstleistungen sind ebenfalls angehalten, ihre digitalen Angebote zugänglich zu machen, auch wenn sie nicht direkt dem BehiG unterstehen.
Die Schweiz orientiert sich dabei, ähnlich wie die EU, an den internationalen WCAG-Richtlinien. Während die EU mit ihrer Accessibility-Richtlinie (European Accessibility Act) klare Vorgaben für den gesamten Binnenmarkt macht, hat der Bund mit eCH-0059 einen eigenen Standard definiert. Dieser lehnt sich an WCAG 2.1 an und gilt als Richtlinie für E-Accessibility in der Schweiz. Beide Regelwerke empfehlen mindestens die Konformitätsstufe AA.
Besonders relevant für Schweizer Organisationen:
- Bundeswebsites müssen WCAG 2.1 Level AA erfüllen
- Die Schweizer Accessibility-Studie bewertet regelmäßig die Zugänglichkeit von Websites
- Die “Stiftung Zugang für alle” bietet Zertifizierungen und Unterstützung
- Das E-Government-Schweiz Programm fördert die digitale Zugänglichkeit
- Für Schweizer Unternehmen, die auch im EU-Raum tätig sind, ist es ratsam, beide Regelwerke zu berücksichtigen. Die rechtlichen Vorgaben sind dabei nicht nur Pflicht, sondern auch Chance: Barrierefreie Websites erreichen mehr Menschen und verbessern die Nutzererfahrung für alle.
Testing und Qualitätssicherung
Eine barrierefreie Website zu entwickeln ist nur der erste Schritt – sie muss auch regelmässig überprüft werden. Dafür gibt es verschiedene Ansätze:
Automatisierte Tests können grundlegende Probleme aufdecken, etwa fehlende Alt-Texte oder zu geringe Kontraste. Tools wie WAVE oder Lighthouse machen diese Prüfung einfach.
Manuelle Tests sind unerlässlich: Die Navigation per Tastatur, das Vorlesen durch Screenreader oder die Prüfung der Verständlichkeit können nicht vollständig automatisiert werden.
Am wertvollsten sind Tests mit den Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Ihre Erfahrungen zeigen oft Hindernisse auf, die technische Tests nicht erkennen. Eine diverse Testgruppe sollte Menschen mit verschiedenen Einschränkungen einschließen – von Sehbehinderungen über motorische Einschränkungen bis zu kognitiven Besonderheiten.

Trends und Zukunft der digitalen Barrierefreiheit
Die Zukunft der digitalen Barrierefreiheit wird massgeblich von technologischen Innovationen geprägt. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine zentrale Rolle: Automatische Alt-Text-Generierung für Bilder, KI-gestützte Untertitelung in Echtzeit und intelligente Vorlesefunktionen machen digitale Inhalte zunehmend zugänglicher.
Neue Interaktionsformen wie Sprach- und Gestensteuerung erweitern die Möglichkeiten der barrierefreien Bedienung. Virtual und Augmented Reality entwickeln sich mit dem Fokus auf inklusive Nutzererlebnisse. Gleichzeitig gewinnt das Konzept des “Adaptive Design” an Bedeutung: Websites und Apps passen sich automatisch an individuelle Bedürfnisse an – von Kontrastverstärkung bis zur vereinfachten Darstellung.
Fazit
Digitale Barrierefreiheit ist der Schlüssel zu einer inklusiven Online-Welt. Sie verbessert nicht nur den Zugang für Menschen mit Einschränkungen, sondern schafft bessere digitale Erlebnisse für alle. Mit fortschreitender Technologie wird barrierefreies Design immer selbstverständlicher – es ist keine Option mehr, sondern ein Must-have für zukunftsfähige digitale Produkte.
Starte jetzt mit der Umsetzung: Nutze unsere Checkliste als ersten Schritt, hole dir Expertinnen ins Team und mache Barrierefreiheit zum festen Bestandteil deiner digitalen Strategie. Denn am Ende profitieren alle von einem Internet ohne Barrieren.


